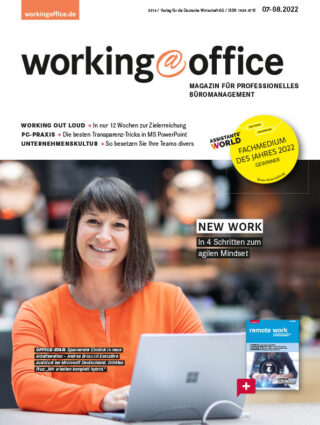© Elenarts/AdobeStock
Schwarze Schwäne in der Wirtschaft
PROGNOSEN Manche Ereignisse treffen den Finanzmarkt derart unvorhergesehen, dass die Wirtschaft dafür eine Metapher gefunden hat: den schwarzen Schwan. Auch in der Politik und in anderen Lebensbereichen wird die Metapher verwendet. Lässt sich aus ihr lernen?
Die Lehman-Brothers-Pleite im Jahr 2008 mit der globalen Finanzkrise in Folge war ein schwarzer Schwan, der Terrorakt 9/11 ebenso, auch die Reaktorkatastrophe in Fukushima und je nach Perspektive auch die Corona-Pandemie. Schwarze Schwäne sind Ereignisse, die wir nicht kommen sehen und die uns absolut unvorbereitet und sehr weitreichend treffen. Wie eben die globale Finanzkrise, in der viele systemrelevante Geldinstitute ohne immens große Rettungsschirme und Bad Banks wie Dominosteine umgefallen wären.
Der Ausdruck geht auf Ende des 17. Jahrhunderts zurück, als schwarze Schwäne in Europa völlig unbekannt waren, kein Mensch hatte sie hier je beobachtet. Erst 1697 sah ein niederländischer Seefahrer sie in Australien. So entstand wohl die Metapher des schwarzen Schwans für ein unwahrscheinliches Ereignis.
Dass ihn heute besonders häufig die Wirtschaftsmedien aufgreifen, geht auf den Finanzmathematiker und ehemaligen Wall-Street-Händler Nassim Nicholas Taleb zurück. Er hat den Black-Swan-Event als Begriff in seinem Buch von 2007 eingeführt und sich zuvor schon einige Jahre mit der Theorie des schwarzen Schwans bei finanzwirtschaftlichen Ereignissen beschäftigt.
Ein schwarzer Schwan kann auch Gutes mit sich bringen
Mittlerweile gilt die der schwarze Schwan nicht mehr nur an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik und Wissenschaft als Metapher für Ereignisse, die uns beispielsweise auch als Gesellschaft völlig auf dem falschen Fuß erwischen, weil sie hinter unserem Erwartungshorizont liegen. Und zwar im negativen ebenso wie im positiven Sinne. So gilt beispielsweise auch die eher zufällige Entdeckung der antibakteriellen Eigenschaften des Penizillins als schwarzer Schwan. Sie revolutionierte praktisch das Gesundheitswesen.
Ein schwarzer Schwan kann im Prinzip alles sein. Allerdings gelten drei Merkmale als charakteristisch: Zum einen ist ein schwarzer Schwan ein unvorhergesehenes Ereignis, das uns quasi wie aus heiterem Himmel erwischt. Zweitens hat das Ereignis eine extreme Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft oder sogar die ganze Welt. Die Tragweite ist also enorm. Und drittens erweist sich ein schwarzer Schwan, wenn das Ereignis dann eingetreten ist, rückblickend als eigentlich vorhersehbar.
Unvorhergesehen, aber rückblickend erklärbar
Denn auch schwarze Schwäne haben Ursachen. Die Finanzkrise 2008 beispielsweise hatte zu einer weltweiten Wirtschaftskrise geführt, mit der keiner gerechnet hatte. Der entzündliche Kern lag im spekulativ aufgeblähten US-Immobilienmarkt mitsamt vielen faulen Krediten, die von zu vielen Kreditnehmern nicht mehr bedient werden konnten. Als Lehmann Brothers kippte, entfaltete sich der Domino-Effekt. Etliche Banken rauschten in die Pleite und nahmen andere mit. Zu wenig Eigenkapital, keine Substanz für den Krisenmodus. Das griff auf andere Branchen über, die Automobilindustrie etwa, die ihre auf schlank getrimmten Zulieferer stützen mussten. Selbst vielen Weltmarktführern fehlte der strategische Notfallkoffer.
Dass aufgeblähte Finanzblasen irgendwann platzen, war an sich nicht überraschend, die Wirkung allerdings schon. Auch Pandemien hat es in der Menschheitsgeschichte bekanntlich schon viele gegeben. Dass wir jederzeit mit einer neuen rechnen müssten, war bekannt. Weiße Schwäne also, auf die man sich vorbereiten kann. Die Wirkentfaltung des neuartigen Virus wurde trotzdem im Vorfeld komplett unterschätzt. Dass unsere Gesundheitssysteme völlig überlasten, harte landesweite Lockdowns nötig würden, die Wirtschaftsleistungen in vielen Regionen zum Erliegen kommen und existenzielle globale Lieferketten reißen, all das kam also trotzdem wie aus heiterem Himmel.
Im Rückblick erkennen wir jedenfalls nicht selten, dass es vorab durchaus Experten gab, die warnten. Unterschätzt, ausgeblendet, für extrem unwahrscheinlich gehalten, weil noch nie beobachtet – aber eben nicht unmöglich.
Rückschaufehler verzerren Zukunftsprognosen
Die Crux: Modelle samt Berechnungen, im Risikomanagement etwa, beziehen sich in der Regel auf vergangene Ereignisse. Etwas, das wie der schwarze Schwan noch nie vorkam, erscheint folglich auch nicht in der Zukunftsprognose und trifft Unternehmen, Politik und Bevölkerung deshalb unvorbereitet.
Und genau deshalb stecken in solchen Phänomenen auch etliche Erkenntnisse. Talebs Theorie zufolge wissen wir viel weniger, als wir glauben zu wissen und sollten die Vergangenheit nicht „naiv“ benutzen, die Zukunft zu prognostizieren, zumal wir uns Dinge bekanntlich gerne schönreden und die Vergangenheit verklären oder verzerren. Rückschaufehler heißt das in der Kognitionspsychologie.
Schwarze Schwäne zeigen uns, dass das, was wir nicht wissen, viel wichtiger sein kann als das, was wir wissen. Sich vorbereiten heißt im Prinzip, nichts für unmöglich zu halten, für Flexibilität zu sorgen, sich breiter aufzustellen. Sich in Sicherheit wiegen, keine Reserven zu bilden und in Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten oder Lieferländern zu begeben, ist hingegen kein guter Plan, wie uns aktuell im Zuge des Ukraine-Kriegs unsere Energieabhängigkeit von Russland zeigt. Ob der Ukraine-Krieg wie ein schwarzer Schwan aufgetaucht ist, sei mal dahingestellt. Wie so oft ist auch das eine Frage der Perspektive.
Schwarze Schwäne decken Schwächen und Risiken auf und weisen auf unsere blinden Flecken hin. Wie fragil unser internationales Finanzsystem beispielsweise ist, wie strukturell geschwächt unser Gesundheitssystem oder wie extrem anfällig die globalisierte Wirtschaft mit ihren komplexen Verflechtungen und wechselseitigen Abhängigkeiten – das haben uns jeweils Black-Swan-Events vor Augen geführt.