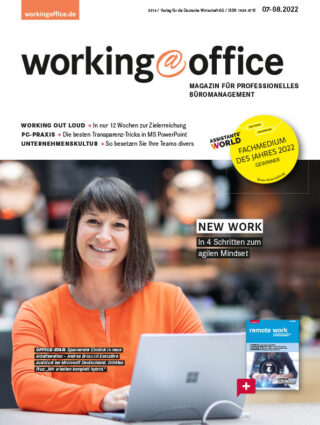© skypicsstudio/AdobeStock
Agil im Kopf
NEW WORK Das Konzept der Agilität wird im Rahmen der digitalen Transformation wieder besonders aktuell. Entscheidend sei aber nicht so sehr die Methodik, sondern das richtige Mindset, erklären zwei Expertinnen.
Business- und Karrierecoach Alexandra Fahnenschreiber hat bereits agile Methoden angewendet, als der Begriff noch nicht so stark im Fokus stand. In der Unternehmensberatung, in der sie viele Jahre angestellt tätig war, wurde zum Beispiel bereits früh die Routine eines wöchentlichen Stand-ups etabliert: ein kurzes Meeting im Stehen mit einem Rückblick der letzten und einer Vorschau der kommenden Woche. „Das ist ein kleines und wirkungsvolles Tool, das sich schnell überall einführen lässt. Denn durch die Kürze und das Stehenbleiben verändert sich bereits ganz viel in der Dynamik eines Meetings“, sagt Alexandra Fahnenschreiber, die heute selbstständig in eigener Coachingpraxis arbeitet.
Auch die Retrospektive, also die Praxis vergangene Projekte im Hinblick auf Geglücktes und Verfehltes zu reflektieren, hat sie als agiles Tool schätzen gelernt. Doch sie kennt auch die Kehrseite von nicht gelingenden Change-Prozessen in Unternehmen, wenn agile Methoden den Mitarbeitenden aufgezwungen werden, ohne sie dabei auf Augenhöhe einzubinden. Oft heiße es: „Wir müssen jetzt agil werden.“ Doch für Unternehmen sei es extrem wichtig, sich vorher zu überlegen: Was ist eigentlich das Gesamtziel? Was leiste ich als Führungskraft, um Veränderungen zu erreichen?
Die Methoden
Bereits in den 1950er Jahren wurde Agilität als Konzept in der Systemtheorie von Organisationen verwendet und später in unterschiedliche Bereiche übertragen. Den Anfang machte die schnelle Produktentwicklung mit multi-funktionalen Teams und fortlaufender Optimierung der Produktionsabläufe, dann folgte der Einsatz in der Softwareentwicklung. Mitte der 1990er-Jahre wurde Scrum als typisch agile Methode entwickelt, die die Zusammenarbeit in Teams mithilfe von Werten, Rollen, Meetings und Werkzeugen effizient und flexibel gestalten soll. Heute wird das Thema Agilität ihm Rahmen von New Work und umfassenden Transformationsprozessen in Unternehmen neu verhandelt und entlang der vier Dimensionen Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kundenzentriertheit und Haltung definiert. „Agile Methoden gibt es haufenweise. Am wichtigsten ist allerdings die Haltung, die dahinter steht: das agile Mindset. Es reicht nicht, Begriffe, Methoden und Tools wie Vokabeln auswendig zu lernen. Man muss diese Sprache auch sprechen können“, sagt Barbara Hilgert.
Agile Methoden und deren Training mit Führungskräften und Mitarbeitenden sind ihr Daily Business: Barbara Hilgert ist Dozentin für New Work und agiles Arbeiten sowie Coach für Scrum und Design Thinking. Letzteres ist eine ebenfalls in den 1990er Jahren entwickelte agile Methode, um komplexe Probleme zu lösen und (Produkt-)Ideen zu entwickeln. Beim Design Thinking gehe es darum, gemeinsam, kreativ und auf Augenhöhe kollaborative Lösungen zu finden, erklärt Barbara Hilgert. Es sei wichtig, dass alle Ideen erst einmal in den Raum gestellt werden dürfen und nichts kritisiert wird. Ganz oft sei nicht die großartigste Idee die beste, sondern eine ganz kleine, die von irgendjemandem von der Seite eingebracht und am Anfang vielleicht nicht beachtet wird. Trotzdem sei das vielleicht die Idee, die am Ende zum Prototypen führt.
Das Mindset
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Informationen in Unternehmen schnell fließen. Agile Methoden bieten die Möglichkeit für ein optimales Wissensmanagement, um implizites Erfahrungswissen in Unternehmen schnell zu teilen. Dies gelinge jedoch nur, so Barbara Hilgert, wenn das auf Augenhöhe geschehe und offen und transparent kommuniziert werde. „Führungskräfte können vernünftige Entscheidungen nur treffen, wenn sie mit ihren Mitarbeitenden, zum Beispiel ihren Assistenzkräften, im Gespräch bleiben und flexibel mit den bisherigen Hierarchien umgehen.“
Einen großen Vorteil von agilen Methoden sieht Barbara Hilgert darin, dass die Bedingungen sehr offen sind, das Wissen frei fließen kann, die Strukturen jedoch vorgegeben werden. Das heißt, es gibt feste Meetings, Termine und Zeiten, was unnötige Verzögerungen und langes Diskutieren ohne Ergebnisse vermeidet und gleichzeitig Wertschätzung gegenüber der Zeit aller Mitarbeitenden zeigt. Barbara Hilgert und Alexandra Fahnenschreiber betonen beide, dass die Einführung von agilen Methoden nur Sinn ergebe, wenn ein Verständnis für ein agiles Mindset sowohl unter Führungskräften als auch Mitarbeitenden besteht. Dies beschreibt die Haltung zu den Themen Arbeit und Führung, den Mitmenschen und sich selbst gegenüber: Ein agiles Mindset begreift die Arbeit als gesellschaftsrelevante Tätigkeit, die sowohl der Zielgruppe als auch den Mitarbeitenden wie Führungskräften dient, um scheinbar Unmögliches zu erreichen.
Lebenslanges Lernen
Das umfasst eine große Lernbereitschaft: „Das Thema Lernen stand für mich schon früh im Fokus“, sagt Alexandra Fahnenschreiber. Sie besuchte neben ihrer Arbeit Seminare und Veranstaltungen und brachte sich bereits als Angestellte immer wieder mit ihrem neu erworbenen Wissen in das Unternehmen ein. Sie teilte ihre Erfahrungen auf informellem Weg, was sie heute zum Beispiel in der Form von Barcamps in Unternehmen wiederfindet – als offene Form der Tagung mit Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmenden zu Beginn mitbestimmt und gestaltet werden.
Für das Erlernen und vor allem Ausprobieren von agilen Methoden empfiehlt Alexandra Fahnenschreiber neben klassischen Kursen und Weiterbildungen vor allem das Training-on-the-job. Zum Beispiel, indem man bei einem konkreten Projekt oder einer Produktentwicklung eine Methode auswählt und ein gemischtes Team inklusive Führungskräfte für einen festen Rahmen von ein bis zwei Monaten von einem agilen Coach begleiten lässt. „Ansonsten gerät man womöglich schnell wieder in alte Muster. Eine Person von außen kann korrigierend eingreifen“, so Alexandra Fahnenschreiber. Im agilen Prozess selbst können spannende Erkenntnisse und Fragen aufkommen: Wird tatsächlich jede oder jeder gemäß der eigenen Stärken und Vorlieben eingesetzt? Wer kann wie führen? Wie wertschätzend gehen wir miteinander um? Das kann wiederum dazu führen, Werte, Prozesse und die Fehler- und Feedbackkultur im Unternehmen zu hinterfragen und neu zu definieren. Am Ende kann nicht nur das Ergebnis des agilen Prozesses stehen, sondern ein neu strukturiertes Team mit einer veränderten Haltung, in der alle mitgestalten dürfen.